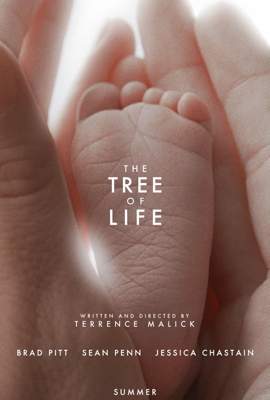„Ich will nur wieder so sein können, wie ich bin“
Franz Bieberkopf verdient sich auf dem Jahrmarkt als Fox, der sprechende Kopf seine Brötchen. Als eines Tages sein Chef festgenommen wird, verliert Franz von heute auf morgen nicht nur seinen Job, sondern auch sein Zuhause und seinen Liebhaber. Vorerst quartiert er sich bei der Schwester ein. Doch diese interessiert sich in der kargen Unterkunft nur für den Alkohol. Und so zieht es Franz schon bald wieder auf die Straße, wo er – als er einen Lottoschein kaufen will – den Industriellen-Sohn Eugen kennenlernt. Für den naiven Franz ist es die große Liebe, für Eugen nur ein einseitiges, temporäres Intermezzo: Die willkommene Gelegenheit an Geld zu kommen. Er lässt sich vom frischgebackenen Lottogewinner Franz aushalten, verleitet ihn zum Geldausgeben und überredet ihn sogar in die elterliche Firma zu investieren.
Rainer Werner Fassbinder und sein alter Ego Franz Bieberkopf - Der ständige Kampf in der Gesellschaft zu bestehen – und die Tragödie doch von ihr überrollt zu werden. Ähnlich wie Döblins Protagonist („Berlin Alexanderplatz“, Franz Biberkopf) findet sich auch der Bieberkopf des Rainer Werner Fassbinder in der realen, unbarmherzigen Welt nicht zurecht, scheitert aufgrund seiner Naivität und Leichtgläubigkeit und erkennt zu spät, dass er der Verlierer eines Spiels ist, dessen Regeln er nicht beherrscht („Ich will nur wieder so sein können, wie ich bin“): Während er an die wahre Liebe und an das Gute im Menschen glaubt, wird er – ohne es zu merken – von Eugen über den Tisch gezogen und benutzt. Die vermeintliche Zugehörigkeit des Proletariers Franz zur kultivierten Mittelschicht ist nur von kurzer Dauer. Sobald das Geld aufgebraucht ist, gehört er nicht mehr dazu.
Rainer Werner Fassbinder sagt, er habe die Story in das Schwulen-Millieu gelegt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu erhalten. Ansonsten hätte die Geschichte genauso auch bei einem heterosexuellen Pärchen spielen können. Vor diesem Hintergrund erinnert der Film umso mehr an „Martha“ (1974, ebenfalls mit Karlheinz Böhm), in dem auch eine ungleiche Beziehung thematisiert wird.Wobei der Fokus ein andere ist: Während es in „Martha“ ums Beherrschen und um Macht geht, will Eugen Franz in „Faustrecht der Freiheit“ primär ausnutzen. Im geht es nicht um Abhängigkeit, sondern um seinen finanziellen Vorteil. Der Sadismus scheint an wenigen Stellen durch, wenn er Franz, den „dummen Proletarier“, beispielsweise im französischen Nobelrestaurant auflaufen lässt. Und so ist auch das Ende, zwangsläufig, ein anderes:
Franz Bieberkopf verdient sich auf dem Jahrmarkt als Fox, der sprechende Kopf seine Brötchen. Als eines Tages sein Chef festgenommen wird, verliert Franz von heute auf morgen nicht nur seinen Job, sondern auch sein Zuhause und seinen Liebhaber. Vorerst quartiert er sich bei der Schwester ein. Doch diese interessiert sich in der kargen Unterkunft nur für den Alkohol. Und so zieht es Franz schon bald wieder auf die Straße, wo er – als er einen Lottoschein kaufen will – den Industriellen-Sohn Eugen kennenlernt. Für den naiven Franz ist es die große Liebe, für Eugen nur ein einseitiges, temporäres Intermezzo: Die willkommene Gelegenheit an Geld zu kommen. Er lässt sich vom frischgebackenen Lottogewinner Franz aushalten, verleitet ihn zum Geldausgeben und überredet ihn sogar in die elterliche Firma zu investieren.
Rainer Werner Fassbinder und sein alter Ego Franz Bieberkopf - Der ständige Kampf in der Gesellschaft zu bestehen – und die Tragödie doch von ihr überrollt zu werden. Ähnlich wie Döblins Protagonist („Berlin Alexanderplatz“, Franz Biberkopf) findet sich auch der Bieberkopf des Rainer Werner Fassbinder in der realen, unbarmherzigen Welt nicht zurecht, scheitert aufgrund seiner Naivität und Leichtgläubigkeit und erkennt zu spät, dass er der Verlierer eines Spiels ist, dessen Regeln er nicht beherrscht („Ich will nur wieder so sein können, wie ich bin“): Während er an die wahre Liebe und an das Gute im Menschen glaubt, wird er – ohne es zu merken – von Eugen über den Tisch gezogen und benutzt. Die vermeintliche Zugehörigkeit des Proletariers Franz zur kultivierten Mittelschicht ist nur von kurzer Dauer. Sobald das Geld aufgebraucht ist, gehört er nicht mehr dazu.
Rainer Werner Fassbinder sagt, er habe die Story in das Schwulen-Millieu gelegt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu erhalten. Ansonsten hätte die Geschichte genauso auch bei einem heterosexuellen Pärchen spielen können. Vor diesem Hintergrund erinnert der Film umso mehr an „Martha“ (1974, ebenfalls mit Karlheinz Böhm), in dem auch eine ungleiche Beziehung thematisiert wird.Wobei der Fokus ein andere ist: Während es in „Martha“ ums Beherrschen und um Macht geht, will Eugen Franz in „Faustrecht der Freiheit“ primär ausnutzen. Im geht es nicht um Abhängigkeit, sondern um seinen finanziellen Vorteil. Der Sadismus scheint an wenigen Stellen durch, wenn er Franz, den „dummen Proletarier“, beispielsweise im französischen Nobelrestaurant auflaufen lässt. Und so ist auch das Ende, zwangsläufig, ein anderes:
Spoiler