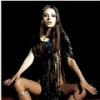Die letzte Sichtung liegt mindestens 25 Jahre zurück, höchste Zeit also für eine Auffrischung. Dass es sich bei der ersten Tonverfilmung des Shelley-Romans um einen Meilenstein des Horrorfilms handelt, steht außer Frage. Karloffs Maske ist für die damalige Zeit als geradezu sensationell zu bezeichnen und prägte das Aussehen der Kreatur für alle Zeiten, die düstere Atmosphäre und das unheimliche Spiel mit Licht und Schatten sind unzweifelhaft dem expressionistischen deutschen Film der 20er Jahre entliehen, die dynamische Kameraführung setzte neue Maßstäbe. Eine der stärksten Szenen des Films ist die schaurige Eröffnungssequenz auf dem Friedhof, in der Frankenstein und sein buckliger Gehilfe einen frisch beerdigten Leichnam stehlen.
Und dennoch weist Whales Arbeit einige ärgerliche Schwächen auf wie beispielsweise die zu sehr in die Länge gezogene Hochzeitsszene oder den hinzugedichteten Tausch des gesunden Hirns gegen das eines Verbrechers. Letzteres suggeriert dem Zuschauer eine daraus resultierende Bösartigkeit der Kreatur, die in Wirklichkeit nicht gegeben ist. Der Mord an Frankensteins Gehilfe ist vor allem auf die schlechte Behandlung zurückzuführen, die dieser der Kreatur hat angedeihen lassen, und die Tötung des kleinen Mädchens ist nicht vorsätzlich sondern vielmehr aus Ungeschick geschehen, weil die Kreatur der Meinung war, es würde ebenso leicht auf dem Wasser schwimmen wie die zuvor hineingeworfenen Blumen. In Wahrheit ist also die Kreatur kein wahnsinniger Mörder, sondern ein unbeholfenes, naives und einsames Wesen, was in den späteren Verfilmungen noch dezidierter herausgearbeitet werden sollte. Irritiert hat mich die Änderung des Vornamens: Frankenstein heißt hier Henry, sein Freund Victor – in Shelleys Vorlage und den späteren Verfilmungen ist es genau umgekehrt.
James Whale
Und dennoch weist Whales Arbeit einige ärgerliche Schwächen auf wie beispielsweise die zu sehr in die Länge gezogene Hochzeitsszene oder den hinzugedichteten Tausch des gesunden Hirns gegen das eines Verbrechers. Letzteres suggeriert dem Zuschauer eine daraus resultierende Bösartigkeit der Kreatur, die in Wirklichkeit nicht gegeben ist. Der Mord an Frankensteins Gehilfe ist vor allem auf die schlechte Behandlung zurückzuführen, die dieser der Kreatur hat angedeihen lassen, und die Tötung des kleinen Mädchens ist nicht vorsätzlich sondern vielmehr aus Ungeschick geschehen, weil die Kreatur der Meinung war, es würde ebenso leicht auf dem Wasser schwimmen wie die zuvor hineingeworfenen Blumen. In Wahrheit ist also die Kreatur kein wahnsinniger Mörder, sondern ein unbeholfenes, naives und einsames Wesen, was in den späteren Verfilmungen noch dezidierter herausgearbeitet werden sollte. Irritiert hat mich die Änderung des Vornamens: Frankenstein heißt hier Henry, sein Freund Victor – in Shelleys Vorlage und den späteren Verfilmungen ist es genau umgekehrt.
James Whale