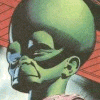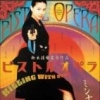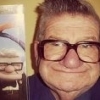The Importance of Being Earnest
Oscar Wilde litt zeit seines Lebens an den gesellschaftlichen Konventionen, die ihm das England des ausgehenden 19. Jahrhunderts auferlegte. Aufgrund seiner lange Zeit unterdrückten Homosexualität hatte er einen geschärften Blick für die inneren Widersprüche des untergehenden Empires. Mit seinen Werken attackierte er sowohl die sexuellen als auch die klassengesellschaftlichen Spielregeln und entlarvte die Doppelbödigkeit der allseits akzeptierten Standards. Sein letztes, erfolgreiches, selbstironisches Theaterstück The Importance of Being Earnest ist nun verfilmt worden und kommt in die deutschen Kinos mit dem Titel Ernst sein ist alles.
Die Story, die Oscar Wilde so wundervoll konstruiert hat, wurde vom Regisseur Oliver Parker nahezu ungebrochen übernommen. Man könnte sie einfach zusammenfassen. Drei Paare suchen sich und finden nach einigen Verwirrungen zueinander. Dies würde aber der Geschichte nicht gerecht werden. Denn der Anlaß der Verwechslungen, die Schaffung einer zweiten Identität für nichtstandesgemäße Vergnügungen oder, wie Wilde es nennt, das Bunburysieren, ist wie ein feiner Stich mit einer Akupunkturnadel in die gesellschaftliche Selbstgefälligkeit – es tut ein bisschen weh und führt im besten Falle zur Heilung. So entfaltet der Film vor den Augen des Zuschauers ein sich ständig änderndes Vexierbild, in dem man den persönlichen Preis für soziale Achtung und die Bedeutung des richtigen Namens für Menschen des 19. Jahrhunderts erkennen kann.
Dies ist aber zugleich das größte Problem des Filmes, denn ich konnte keinen Bezug zur heutigen Realität herstellen. Sicher erfreuten mich die geschliffenen Dialoge, sicher erheiterte mich Lady Bracknells herablassende Unnahbarkeit, die einer ehemaligen Cancantänzerin besonders gut steht. Dennoch war der Film wie der herbeigewehte Klang eines Spinetts und ließ mich merkwürdig unberührt.
Dies findet seine Entsprechung auch auf der visuellen Ebene des Filmes, zu viel wird dem Vorbild Theater gehuldigt, zu wenig werden die Mittel des Kinos ausgenutzt. Eine der wenigen gelungenen Ausnahmen ist die sich wiederholende Replik auf die kitschigsten Ritterromanzen aller Zeiten, mit denen Gwendolens Aussage "Wir leben im Zeitalter der Ideale." bildlich umgesetzt wird. Die meiste Zeit aber bewegen sich die präsentierten Filmfiguren wie Marionetten aus Lackpapier durch aufdringlich gekünstelte Kulissen. Dieser Eindruck ist vermutlich vom Regisseur gewollt und nicht auf das Unvermögen des Schauspielerensembles zurückzuführen, das Oliver Parker versammelt hat. Besonders hervorzuheben ist Judy Dench als Lady Bracknell (sehr gelungen die Anhörung der potentiellen Heiratskandidaten) und Reese Witherspoon als jugendlich-naive Nichte Cecily. Demgegenüber fielen die Männerrollen deutlich ab. Schon aus dem Grunde, weil sie trotz Maske zu viele Falten für den jugendlichen Liebhaber aufwiesen. Besonders Rupert Everett, der Darling der schwulen Community, erschien mir als Befreier der holden Maid reichlich fehlbesetzt. Man könnte sich höchstens mit einer Widerspiegelung von Schauspiel und Wirklichkeit herausreden, denn auch der von Everett verkörperte Algernon bunburysiert in Gefilden, die sich der Zuschauer selbst ausmalen muss.
Oscar Wilde wollte nach eigenem Bekunden einer der wichtigsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts werden,wurde aber einer der wichtigsten Wegbereiter für die Literatur des 20. Jahrhunderts. Nicht die schlechteste Art und Weise, wie man sein Ziel verfehlen kann. Oliver Parker hat sein Ziel, das Kinopublikum zu unterhalten, weitaus schlechter verfehlt.
Zuerst veröffentlicht auf kino.de am 14.09.2002
kino.de
Oscar Wilde litt zeit seines Lebens an den gesellschaftlichen Konventionen, die ihm das England des ausgehenden 19. Jahrhunderts auferlegte. Aufgrund seiner lange Zeit unterdrückten Homosexualität hatte er einen geschärften Blick für die inneren Widersprüche des untergehenden Empires. Mit seinen Werken attackierte er sowohl die sexuellen als auch die klassengesellschaftlichen Spielregeln und entlarvte die Doppelbödigkeit der allseits akzeptierten Standards. Sein letztes, erfolgreiches, selbstironisches Theaterstück The Importance of Being Earnest ist nun verfilmt worden und kommt in die deutschen Kinos mit dem Titel Ernst sein ist alles.
Die Story, die Oscar Wilde so wundervoll konstruiert hat, wurde vom Regisseur Oliver Parker nahezu ungebrochen übernommen. Man könnte sie einfach zusammenfassen. Drei Paare suchen sich und finden nach einigen Verwirrungen zueinander. Dies würde aber der Geschichte nicht gerecht werden. Denn der Anlaß der Verwechslungen, die Schaffung einer zweiten Identität für nichtstandesgemäße Vergnügungen oder, wie Wilde es nennt, das Bunburysieren, ist wie ein feiner Stich mit einer Akupunkturnadel in die gesellschaftliche Selbstgefälligkeit – es tut ein bisschen weh und führt im besten Falle zur Heilung. So entfaltet der Film vor den Augen des Zuschauers ein sich ständig änderndes Vexierbild, in dem man den persönlichen Preis für soziale Achtung und die Bedeutung des richtigen Namens für Menschen des 19. Jahrhunderts erkennen kann.
Dies ist aber zugleich das größte Problem des Filmes, denn ich konnte keinen Bezug zur heutigen Realität herstellen. Sicher erfreuten mich die geschliffenen Dialoge, sicher erheiterte mich Lady Bracknells herablassende Unnahbarkeit, die einer ehemaligen Cancantänzerin besonders gut steht. Dennoch war der Film wie der herbeigewehte Klang eines Spinetts und ließ mich merkwürdig unberührt.
Dies findet seine Entsprechung auch auf der visuellen Ebene des Filmes, zu viel wird dem Vorbild Theater gehuldigt, zu wenig werden die Mittel des Kinos ausgenutzt. Eine der wenigen gelungenen Ausnahmen ist die sich wiederholende Replik auf die kitschigsten Ritterromanzen aller Zeiten, mit denen Gwendolens Aussage "Wir leben im Zeitalter der Ideale." bildlich umgesetzt wird. Die meiste Zeit aber bewegen sich die präsentierten Filmfiguren wie Marionetten aus Lackpapier durch aufdringlich gekünstelte Kulissen. Dieser Eindruck ist vermutlich vom Regisseur gewollt und nicht auf das Unvermögen des Schauspielerensembles zurückzuführen, das Oliver Parker versammelt hat. Besonders hervorzuheben ist Judy Dench als Lady Bracknell (sehr gelungen die Anhörung der potentiellen Heiratskandidaten) und Reese Witherspoon als jugendlich-naive Nichte Cecily. Demgegenüber fielen die Männerrollen deutlich ab. Schon aus dem Grunde, weil sie trotz Maske zu viele Falten für den jugendlichen Liebhaber aufwiesen. Besonders Rupert Everett, der Darling der schwulen Community, erschien mir als Befreier der holden Maid reichlich fehlbesetzt. Man könnte sich höchstens mit einer Widerspiegelung von Schauspiel und Wirklichkeit herausreden, denn auch der von Everett verkörperte Algernon bunburysiert in Gefilden, die sich der Zuschauer selbst ausmalen muss.
Oscar Wilde wollte nach eigenem Bekunden einer der wichtigsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts werden,wurde aber einer der wichtigsten Wegbereiter für die Literatur des 20. Jahrhunderts. Nicht die schlechteste Art und Weise, wie man sein Ziel verfehlen kann. Oliver Parker hat sein Ziel, das Kinopublikum zu unterhalten, weitaus schlechter verfehlt.
Zuerst veröffentlicht auf kino.de am 14.09.2002
kino.de