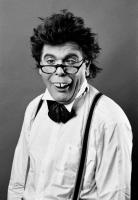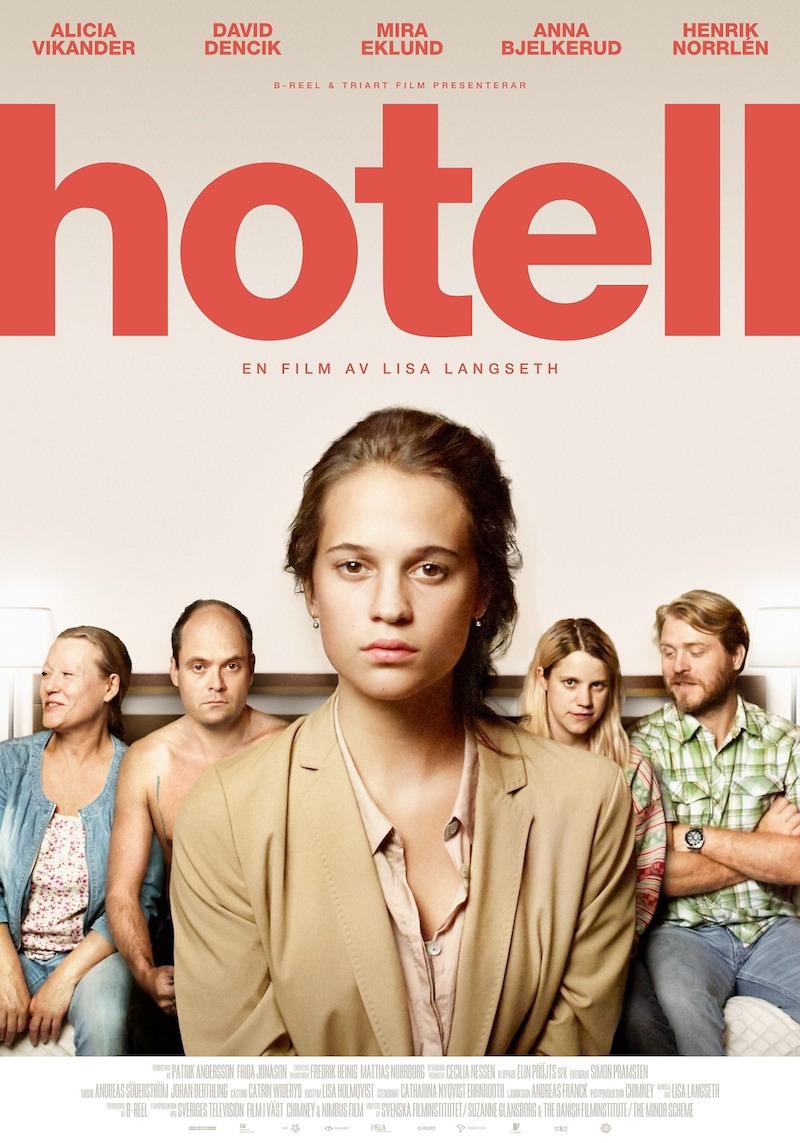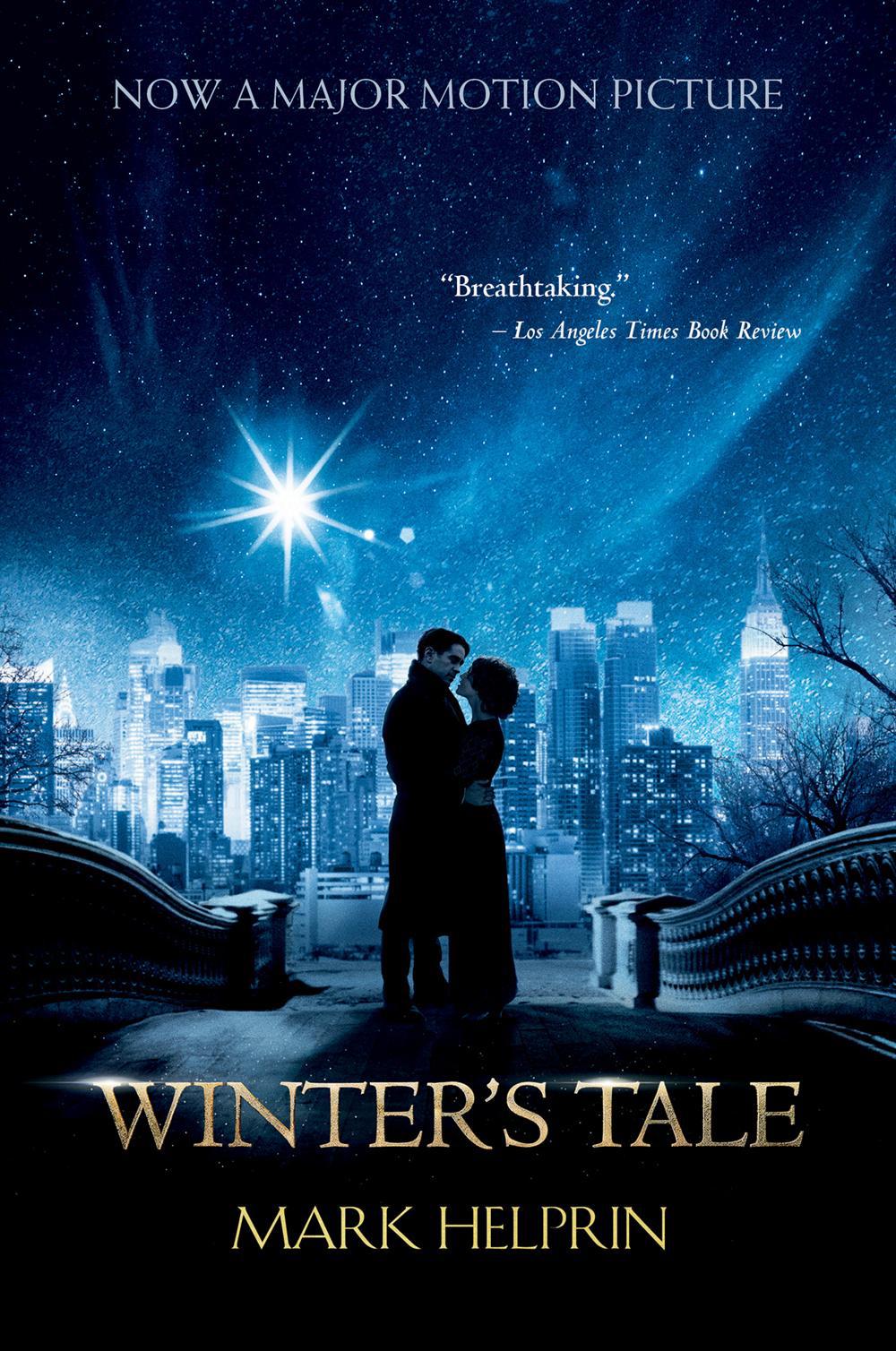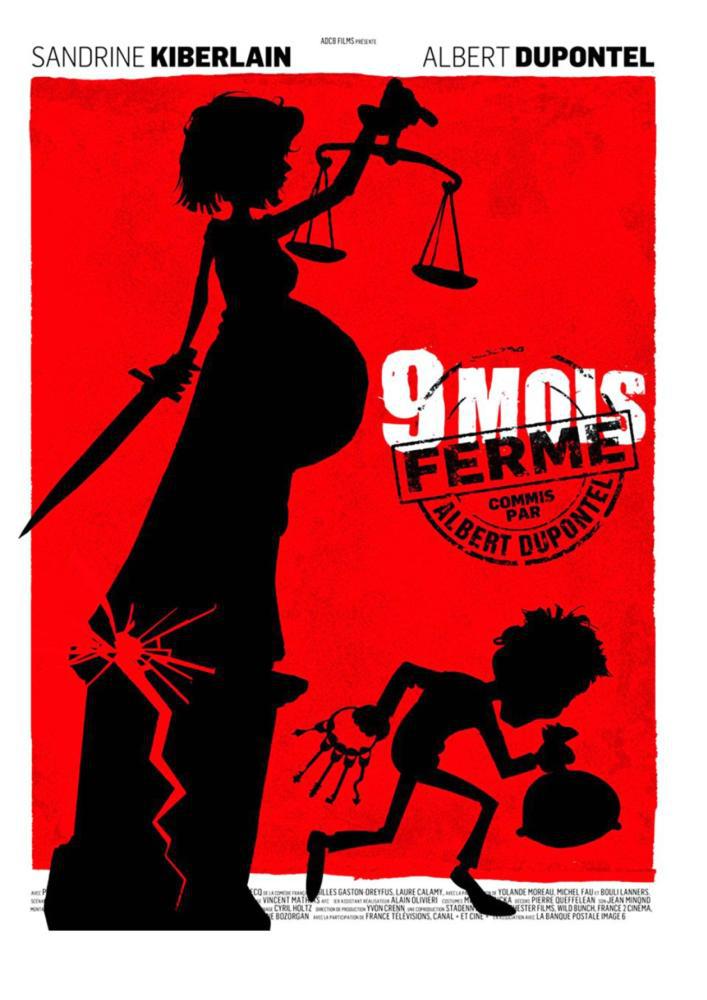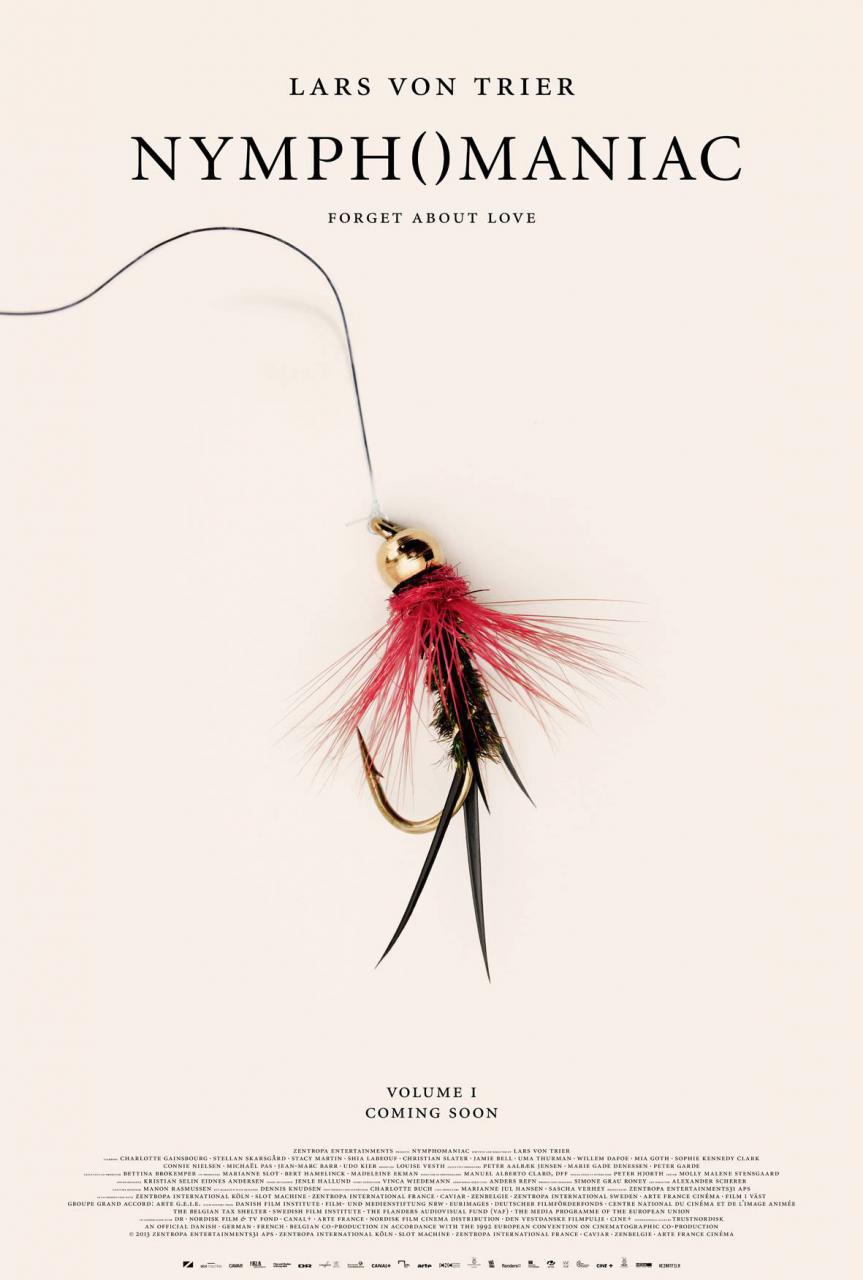Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Zum zweiten Aspekt: da finde ich noch erwähnenswert, dass beide letztlich gedungene Schläger (in einem anderen Film wären sie Auftragskiller oder Söldner) sind - und bleiben. Über Colt erfährt man sowieso wenig, aber auch Tang Long ist (und bleibt ?) ein Außenseiter in seiner Gruppe.
Der gedungene Schläger ist Colt, da er bereit ist, seine Fähigkeiten für Geld anzubieten. Sogar bereit ist, für Geld zu töten. Und das, obwohl er offensichtlich Schüler hat, die er unterrichtet. Er wird also als jemand skizziert, der nicht völlig aus dem Nichts kommt, doch er hat sich für die moralisch falsche Seite entschieden.
Tang Long hingegen ist die Apotheose der Figur, die Lo Wei in den ersten beiden Filmen mit Bruce Lee eingeführt hat, die Lee noch weiter entwickeln wollte und die essentiell für das Martial-Arts-Kino der 1970er werden sollte: Der einfache Bursche vom Land, der aus nicht näher spezifizierten Gründen ein Superkämpfer ist und sich für eine gerechte Sache versucht einzusetzen, damit aber letztlich die Probleme nicht wirklich löst. Der Unterschied zu dem komplexen Anti-Helden-Monument Ethan Edwards (der ja seinerseits eine Apotheose von Heldenfiguren einer vorherigen Entwicklung ist, aber als allumfassendes Monument sämtliche Helden-Entitäten und deren Gegenteil in sich vereint) ist, dass der Zuschauer die Tragik seiner Figur auf einem Stream erfahren soll. Mit Edwards kann man mitempfinden, oder ihn hassen, oder er lässt einen kalt oder was auch immer. Tang Long reiht sich ein in die Gruppe derer, die einem am Ende leidtun können. Seit Lees Cheng Li in DIE TODESFAUST DES CHENG LI lastet das Unvermögen auf Lees Kämpferfiguren durch den Kampf die Probleme in der komplexen Welt zu lösen. Aber er gibt uns ein Gefühl von Retribution. Während bei diesem Film wirklich überhaupt keine Erklärung für Lees Befähigung sogar den Meister zu besiegen gegeben wird, so ist er in TODESGRÜSSE AUS SHANGHAI zumindest ein Schüler Huo Yuanjias und darf den nationalistischen Helden-Tod sterben. Genau diese nationalistischen Tendenzen sollen Lee missfallen haben und er gestaltet die Figur stärker als einsamen Wolf. Er kommt aus den New Territories, was bedeutet, dass er in Armut groß geworden ist. Er kommt vom Lande und gibt selbst an, von der Stadt keine Ahnung zu haben. Er kann lateinische Buchstaben nicht lesen (es ist fraglich, ob er kompletter Analphabet ist) ist ungebildet, linkisch, fast schon tölpelhaft. Die Szene am römischen Flughafen ist von einer bravourös-dezenten Komik. Allein wie Lee (der Regisseur) sich als machtlos gegenüber der ihn (die Hauptfigur) anstarrenden Italienerin inszeniert. Wie er ein Kind erschreckt und selbst in Panik wegläuft. Wie er die Speisekarte von oben nach unten bestellt, weil er nicht mal weiß, dass man bei uns von links nach rechts liest. Und bei allem so tut, als hätte er den absoluten Durchblick, große Gesten von weltmännischer Lebensart imitierend, die zur unfreiwilligen Parodie seiner selbst werden, von Chin Hua zunächst nur entnervt zur Kenntnis genommen (der Running Gag, dass er immer nach der Toilette fragt, weil er aufgrund seiner Fehlbestellung die Scheißerei hat). All das sind Elemente, die nicht den großen Regulator erwarten lassen, als der er geschickt wurde. Und da haben wir das Aufeinanderprallen der Zeiten. Er wurde vom "großen Onkel" geschickt, um das Problem zu lösen. Entsandt wie in eine Provinz, um dort nach klassischer Art zu helfen. Chin Hua kann bei seiner Ankunft nur feststellen: "Ich dachte mein Onkel schickt einen Anwalt?" Doch Tang Long sieht aus wie ein Penner, oder eher wie ein armer Chinese. Nicht passend zum westlichen Stil, dem sich die Kellner und Chin Hua inzwischen angepasst haben. Doch niemand bemerkt, dass Tang Long den zwar einfach gehaltenen, aber traditionellen Anzug eines Großmeisters trägt. Und auch Tang Long plustert sich nicht in diese Richtung auf. Er ist und vor allem er bleibt ein einfacher Bursche vom Land. Als Chin Hua ihm die abendländische Kultur nahe bringen möchte interessiert er sich nicht dafür. Als er die Ruinen der alten Römer sieht, kann er nur sagen: "Slums gibt's in Hongkong genug."
Letztlich ist der Film eine Anti-Helden-Zelebrierung des Einen, der der Beste ist. Auch, wenn er kein Stück zur Lösung des Problems beigetragen hat. Er ist der Beste. Und es ist einsam, der Beste zu sein. Allerdings stellt Lee dies reflektiert da. Er hätte sein Drehbuch ja auch anders verfassen können, aber nein, er ordnet alles genau an, um zu zeigen, dass er der beste Kämpfer ist, dass dies allerdings in unserer Welt nichts bringen muss. Anders als in DER SCHWARZE FALKE verdichtet Lee stärker in einen Realismus der Konfrontation und Unausweichlichkeit, lässt seiner Figur aber auch einen Funken mehr Hoffnung, da es am Ende für Edwards wirklich nichts anderes als den Tod, oder das, was dahinter liegt, gibt. In DIE TODESFAUST DES CHENG LI ist es die staatliche Institution Polizei, die Cheng Li stoppt (sehr an Rays ... DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN angelehnt), bei TODESGRÜSSE AUS SHANGHAI stirbt Lee zwar, aber es ist der Helden-Tod fürs chinesische Volk und damit ehrenvoll. Die reifste Anti-Helden-Figur liefert Lee wirklich hier ab. Schade, dass dies seine einzige Regiearbeit bleiben sollte.
 Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Zwar auch Chinese, aber erst einmal muss er die Rivalitäten überwinden, dann später ist er der "große Bruder", aber eben doch nicht Familie. Nur die Frau kann diese letzte Grenze überwinden, etwas, was er dann wiederum nicht annehmen kann.
Ja, das ist die ewige Unangepasstheit. Auf der einen Seite ist der Held durch seine Befähigungen nützlich, auf der anderen Seite passt er nicht zu der Gesellschaft, deren Bestehen er überhaupt ermöglicht (hat). Das sind ja letztlich die modernen Heldendarstellungen unserer heutigen Zeit. Die Figuren haben alle Befähigungen, um "den Tag zu retten", aber ihre Fähigkeiten werden einer realistischen kulturanthropologischen Betrachtung unterzogen. So, wie ADHS oder Adiposität evolutionäre Vorteile bedeuten, so sind sie in der zivilen Gesellschaft fehl am Platze. Die gesteigerte Aggressivität des Helden, die dieser mitbringen muss, ist störend in einer friedlichen Gesellschaft. Als Ethan Edwards nach Hause kommt, schlägt ihm ein Klima der Ablehnung entgegen (außer von seiner Schwägerin, da beide wohl verliebt waren, sie sich aber für den sicheren Bruder entschied, und von Kindern). Als die Figur von Ward Bond bemerkt, dass Edwards wieder da ist, scheint er fast Angst zu haben, vor dem was dieser tun könnte und verweist darauf, dass er jetzt hier für Ruhe und Ordnung zuständig ist.
Letztlich fallen die meisten Darstellungen danach wieder auf einen bestimmten Punkt zurück. Sie bemühen sich in der Wahl ihrer Mittel realistischer, eindringlicher und eben weniger mythologisch aufgeblasen zu erscheinen, aber sind letztlich doch reaktionär in ihrer Gesinnung, dass sich aus dem gewalttätigen Handeln des (Anti-)Helden doch Positives für die friedliche Gesellschaft ableiten lässt. Und wenn es nur darum geht, die Einsamkeit des Helden zu bewundern, seinen Pathos. Auch das kommentiert Ford durch die Inszenierung der Rettung von Edwards Nichte. Bis zum Cut-Ruf wussten beide Darsteller nicht, ob Edwards seine Nichte nun tatsächlich rettet oder zerschmettert. Natalie Wood meinte noch nach Jahren, so viel Angst wie vor John Wayne hatte sie nie wieder in ihrem Leben. Ford inszeniert noch bis zur letzten Einstellung einen möglichen Amok-Mord an einem Kind und lässt sie dann doch am Leben. Angesprochen auf das Verhalten seiner Figur bzw. amerikanisches Verhalten generell, äußerte sich Ford mal erstaunlich direkt, dass wenn bei so einem Verhalten was Gutes rumkommt, dann nur durch Zufall. Es ist ein Affekt, der darüber entscheidet ob sich alles zum Guten wendet, oder eben in einer Katastrophe mündet. Nicht das kontrollierte, überlegte und überlegene Verhalten einer einzelnen Helden-Figur. Auf diesen Punkt der vermeintlichen Kontrolliertheit fallen alle Leones, Siegels, Eastwoods, Bronsons, McQueens, Stallones (In RAMBO wird allerdings grandios damit "gespielt"), Arnies (der konnte ja schon immer in die Parodie flüchten) usw. zurück.
 Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Bastro sagte am 06. März 2014, 08:17:
Eine ganz ähnliche Gruppendynamik gibt es übrigens im Neo-Western DAS FINSTERE TAL, wo am Ende die moralische Spitze eben genau dieses Außen-vor ist, das nicht überwunden wird. Und zwar ausgerechnet von denen, die von der Hilfe des Fremden profitierten. Da er allein durch seine Anwesenheit sie an ihre Verfehlungen erinnert. Man ist froh, wenn man ihn wieder los ist - obwohl er die Erlösung gebracht hat.
Und das ist ja das Ende von DER SCHWARZE FALKE in Reinform. Die Einmaligkeit von Fords Bildsprache lässt sich darin finden, dass er in einer Einstellung erzählen kann, was andere durch Montage, oder sogar mehrere Szenen auflösen müssen. Die Kamera filmt aus der Schwärze der Blockhütte, das neue Amerika, aus dem die verängstigten Gestalten schleichen, sie nehmen die Tochter, trotz Verwahrlosung, wieder an, obwohl sie sie aufgegeben hatten. Abgeschlossen hatten. Ethan bringt ihnen also ein Geschenk, er hat das Unmögliche möglich gemacht (nur wir und das Halb-Blut wissen, wie knapp das war), und alle fangen an sich zu freuen. Und niemand kümmert sich um Ethan. Keines Blickes würdigen ihn die Anderen. Nicht mal das Halb-Blut, das jahrelang mit Edwards geritten ist, würdigt ihn noch eines Blickes, sondern geht auch in die Amerika-Hütte. Ethan hat "den Tag gerettet", aber für ihn interessiert sich niemand. Nachdem der letzte in die Hütte gegangen ist, kommt die legendäre feminine Szene: Ethan knickt etwas ein und hat endlich Zeit sich seine Wunde zu halten. Auch er fühlt Schmerz, aber jetzt hat er endgültig keine Aufgabe mehr. Er dreht sich um und geht einen entschlossenen Schritt auf die Prärie - Sinnbild für die exitenzialistisch-dekonstruktivistische Auflösung - zu und in diesem Moment rummst die Tür zu. Denn auch wir sind nicht mehr an dem beteiligt, was da folgen wird.
In WESTLICH ST. LOUIS (1950) lässt Ford seine Mormonen, Puritaner, Huren, Glücksspieler, Gaukler, Strauchdiebe, Mörder und die beiden Hauptfiguren hinter dem Präriehügel tatsächlich noch in eine dekontruktivistische Traumwelt entkommen. Ben Johnson ist ein meisterlicher Schütze, aber er würde seine Waffe nie gegen Menschen einsetzen, sagt er. Er schieße nur ab und zu mal auf Schlangen. Doch am Ende muss er auf einen Menschen schießen und es ist klar: jetzt wird er nicht mal mehr auf Schlangen schießen können. Als sie am Ende hinter den Hügel kommen, präsentiert Ford eine Montage aus im Film Passiertem und aus Wunschvorstellung, durch die Montage Raum und Zeit auf eine Art aufbrechend, dass ich ungefähr eine halbe Minute auf den Bildschirm schaute und irgendwann merkte, dass ich überhaupt nicht mehr verstand, was vor sich geht. Ich sah nur noch Bilder, die schwach strukturiert schienen und dann war es vorbei. Diese positive Auflösung aller Strukturen kann Edwards nicht finden, denn hinter der unwirtlichen roten Landschaft verbirgt sich nur die nächste Felswüste. Oder auch Schneelandschaften (das deckt Ford ja auch noch ab) oder was auch immer. Auf jeden Fall ein Land, dass keine Frontier mehr bietet, ihn mit der Sinnlosigkeit seiner Existenz konfrontiert und ihn auffordert, sich aufzulösen. Die
final frontier (Tod, oder was dahinter liegt) zu übertreten. Eine Auflösug, die ins Philosophische drängt, da sie physikalisch nicht möglich scheint.
 sicomastik sagte am 06. März 2014, 01:02:
sicomastik sagte am 06. März 2014, 01:02: