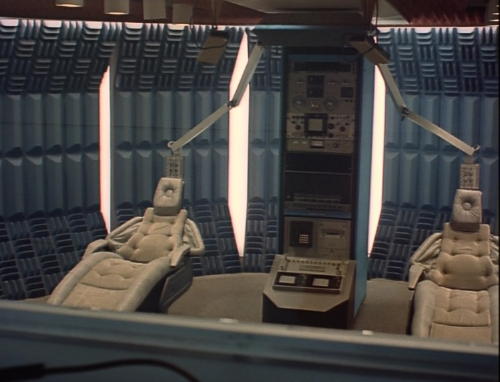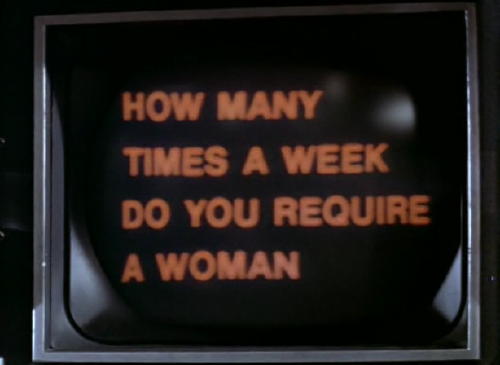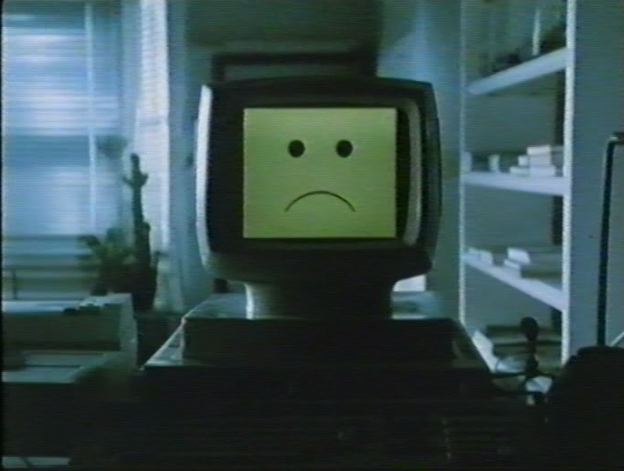Ein Tag ohne Achternbusch-Film kommt mir sinnlos und leer vor.

Aber was heute von ihm gezeigt wurde, kenne ich bereits alles. Daher habe ich nur drei Filme auf dem Programm und früh Feierabend:
Lonely Tunes of Teheran (Taraneh tanhaïye Tehran, Iran 2008, Saman Salur)
Die beiden Cousins, der kleinwüchsige Hamid und und der Riese Behrouz, installieren illegal Satelliten-Anlagen auf Wohnhäusern in Teheran. Obwohl das Untergrund-Geschäft einträglich sein müsste, leben sie von der Hand in den Mund. Eines Tages werden sie von einer alleinstehenden Frau angeheuert, in die sie sich beide prompt verlieben. Aber weil sie schon zu oft zurück gewiesen wurden, traut sich keiner einen Annäherungsversuch zu starten. Dann verliert Hamid seine Wohnung, weil der Vermieter genug von dessen illegalem Treiben hat. Die beiden Cousins müssen sich entscheiden, ob sie ihre Einsamkeit miteinander teilen oder sich voneinander trennen wollen. Salurs Film ist selbst ein Underground-Werk. Tagsüber auf 16 mm, nachts mit Video, immer ohne Beleuchtung und meistens ohne Stativ gedreht, erzählt er eine Geschichte vom so genannten "normalen Wahnsinn" in einer Diktatur. Entgegen vielleicht vorherrschenden Vorstellungen kann man(n) in Teheran offenbar nicht nur gut, sondern auch einigermaßen unbehelligt von der Staatsmacht leben - wenn man(n) nur genug aufpasst. Die Kamera wählt zum Erzählen zumeist sehr lange Brennweiten, die die filmischen Räume in der Tiefe stark staucht, so dass immer ein Eindruck von Enge vorherrscht. Das passt zu der mit Menschen gefüllten Einsamkeit der Erzählung der beiden Cousins - einer der beiden Schauspieler hat den Start des Film offenbar nicht mehr erlebt, wie einer Widmung im Abspann zu entnehmen ist.
The Oxford Murders (Sp/F 2008, Aléx de la Iglesia)
Ein Serienmörderfilm auf dem Münchener Filmfest. Lasse ich mir den entgehen? Nein, natürlich nicht. Hätte ich aber besser. Eine sehr im Stil Agatha-Christie'scher Krimiprosa erzählte Whodunnit-Geschichte, die Mitte der 1990er-Jahre im Uni-Milieu, genauer gesagt: in der Mathematischen Fakultät von Camebridge angesiedelt ist. Ein junger amerikanischer Austauschstudent (Eliah Wood) sucht die Nähe eines philosophisch angehauchten Numerik-Professors (William Hurt), perlt aber mit seinen Avancen ab - bis die beste Freundin des Professors ermordet aufgefunden wird, die zufällig auch die Vermieterin des Austauschstudenten ist. Fortan bemühen beide ihren logischen Verstand um das Serienmordrätsel zu lösen, das sich nach doppeltem Plottwist jedoch als Hirngespinst zu erweisen scheint. Solide erzählt, altbacken, Hollywood-like.
Eine sehr schöne Kamerafahrt zu Beginn, die aber nur dazu da ist, "clues" zu streifen, die wie Beiläufigkeiten aussehen. Ansonsten begnügt sich das Bild damit, das zerfurchte Gesicht William Hurts und die ozeanblauen Augen Eliah Woods - na ja, und die Anatomie Leona Watlings - einzufangen. Das wäre alles noch nicht ärgerlich, wenn hier nicht wieder einmal ein peinlich verzerrtes Bild akademischer Geisteswissenschaft hingeschmiert würde. Protest muss jeden Bachelor im 2. Semester Philosophie entfleuchen, wenn er sich den Unsinn anhört, der den Figuren da in den Mund gelegt wird. Professor Hurt gefällt sich darin, außer Wittgensteins Tractatus und einer Reihe Kalendersprüche nichts gelesen zu haben und seine Studenten pflichten ihm bei. Was "I. Q." für die Physiker ist, ist "Oxford Murders" nun für die Philosphen: Ein Anlass vor Fremdscham im Kinoparkett zu versinken.
Handle me with care (Thailand 2008, Kongdej Jaturunrutasamee)
Die positive Erkenntnis zuerst: Die thailändische Filmindustrie steht in Sachen Qualitätskino weder der asiatischen noch der westlichen Konkurrenz hintan. "Handle me with Care" ist ein durch und durch gelungen produzierter Film mit Stars, zumindest zu Beginn sehr schönem Soundtrack und vollendetem (unsichtbarem) Schnitt. Er erzählt die Geschichte eines dreiarmigen jungen Mannes, dessen Hemdschneider stirbt und der sich (nicht nur) deshalb entschließt, sich den zuvielen linken Arm in Bangkok amputieren zu lassen. Außerdem will er dort dann seinen Vater wieder treffen, der die Familie nach der Geburt des dreiarmigen Babys verlassen hat. Unterwegs trifft er auf eine junge Frau, die so große Brüste hat, dass die Männerwelt sie nicht nur darauf reduziert, sondern sie während des Films auch zwei Mal Beinahe-Opfer von Vergewaltigungen wird. Auch sie will nach Thailand und ihren abhanden gekommenen Ehegatten suchen. Die Zwei tun sich zusammen und werden in all ihrem Leid ein Paar. Sie will, dass er sich mit seinen drei Armen akzeptiert, er will das nicht, aber ihre großen Brüste anfassen. Sie trennen sich, Arm kommt ab, Leben wird normal, sie kommen wieder zusammen. Aus. Mit der Qualität hat leider auch die Heteronoramtivität Einzug in den thailändischen Film gehalten. Fürchtet man zu Beginn noch, dass der Dreiarmige seinen Arm behält und aus dem Film damit ein Lehrstück über Akzeptanz und Toleranz wird, so tritt genau das andere schlechte Ende ein, in dem (nur) die Normalität zum Ziel führt. Hätte "Handle me with care" überhaupt ein gutes, ansprechendes Ende nehmen können? Als Komödie hat er sich zu schnell selbst vergessen, als Liebes-Melodram kommt er nicht so recht in die Gänge. Tja, was soll's denn nun sein? Ein Film, der sicherlich vielen gefallen wird.